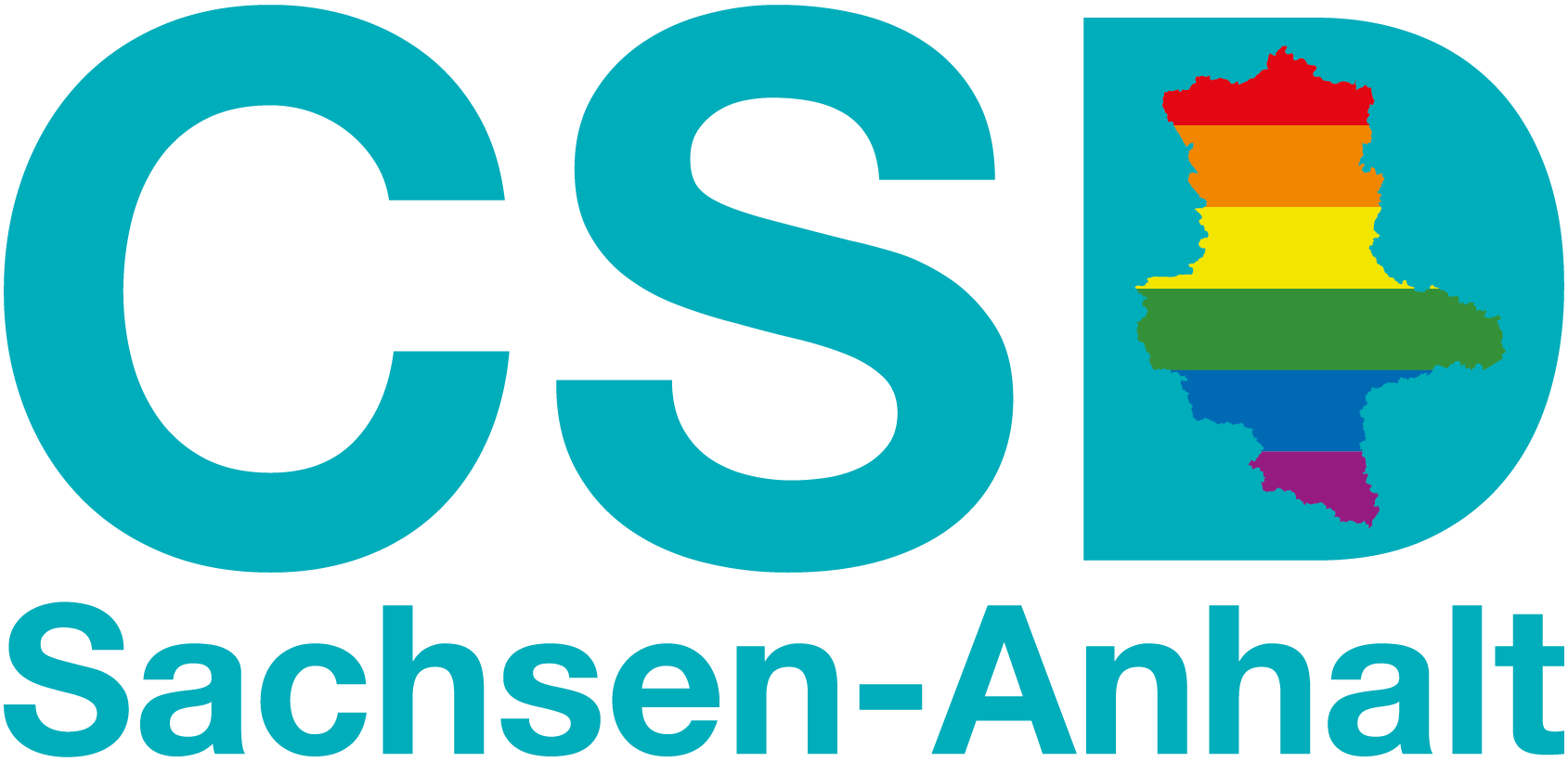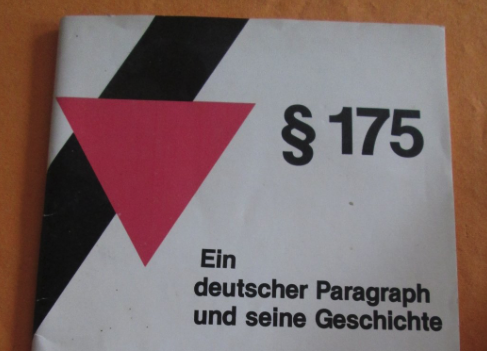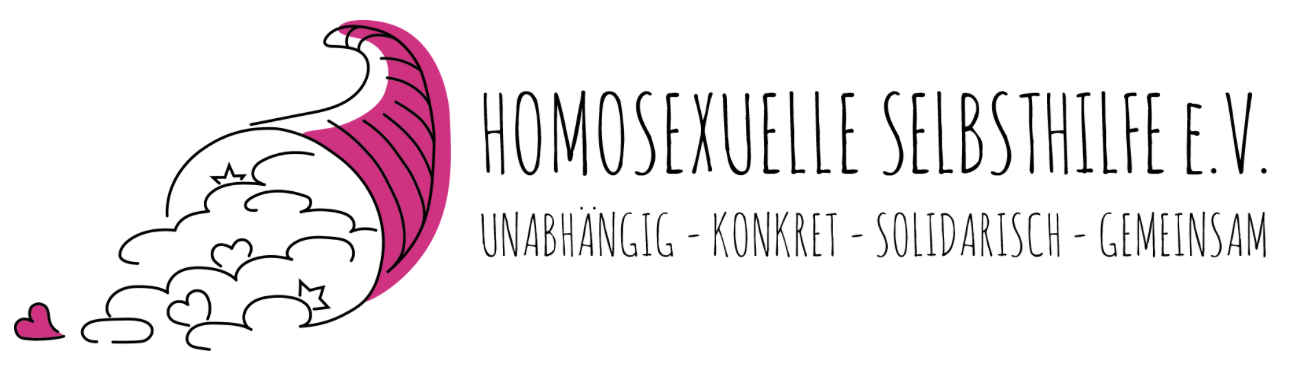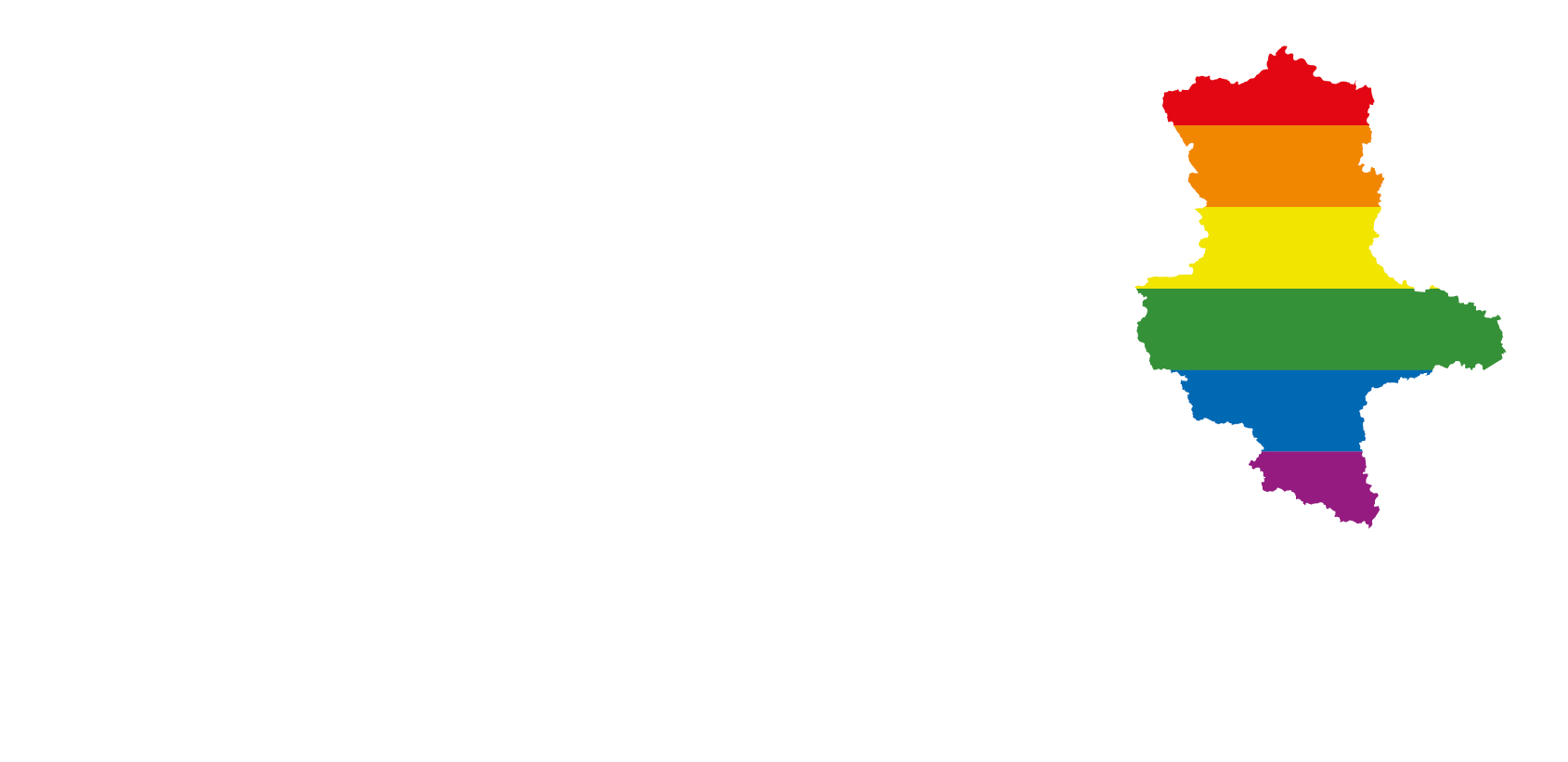Einführung in das Projekt zur Sichtbarmachung der Verfolgung nach § 175 StGB in Sachsen-Anhalt
Über 123 Jahre lang war gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Männern in Deutschland unter Strafe gestellt. Der § 175 des Strafgesetzbuches kriminalisierte Homosexualität mit weitreichenden Folgen für zehntausende Menschen – auch in Sachsen-Anhalt.
Gemeinsam mit dem Zeithistoriker Dr. Christian-Alexander Wäldner haben wir uns auf den Weg gemacht, diese Geschichte nicht nur zu erzählen, sondern sichtbar zu machen. Ziel ist es, das Leid, die Diskriminierung und die strukturelle Gewalt, die queere Menschen auch in unserer Region erfahren haben, dauerhaft im kollektiven Gedächtnis zu verankern.
Die digitale Karte
Zentrales Element unseres Projekts ist eine digitale Karte, die Orte und Ereignisse in Sachsen-Anhalt dokumentiert, die im direkten Zusammenhang mit dem § 175 stehen. Sie macht sichtbar, wie flächendeckend und systematisch Menschen verfolgt wurden – nicht irgendwo, sondern direkt vor unserer Haustür: in Städten, Dörfern, Polizeistationen, Gerichtssälen und Gefängnissen unserer Region.
Die Karte ist bewusst so gestaltet, dass sie nicht nur historische Ereignisse dokumentiert, sondern auch pädagogisch und erinnerungskulturell nutzbar ist – etwa für Workshops, Schulprojekte oder Stadtrundgänge.
Historischer Hintergrund: Sachsen-Anhalt unter dem Schatten des § 175
Die Verfolgung queerer Menschen in Sachsen-Anhalt hatte viele Gesichter. Bereits in der Kaiserzeit und während der Weimarer Republik wurden Menschen auf Grundlage des § 175 angeklagt. Mit der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933 verschärfte sich die Situation dramatisch. Der Paragraf wurde erweitert, die Strafbarkeit ausgeweitet – das führte zu zahlreichen Verhaftungen, Demütigungen und auch Deportationen.
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich die Kriminalisierung fort: In der DDR galt der § 175 in veränderter Form bis 1988, in der Bundesrepublik blieb er sogar bis 1994 in Kraft. Diese Kontinuität der Verfolgung ist ein bitteres Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte – und wurde in Sachsen-Anhalt bislang viel zu selten beleuchtet.
Unser Anliegen: Aufklären, Erinnern, Sichtbarmachen
Mit unserer Arbeit möchten wir:
- individuelle Schicksale sichtbar machen, die bislang in Archiven oder persönlichen Erinnerungen verborgen waren,
- historische Orte identifizieren, an denen Unrecht geschah – darunter ehemalige Gerichtsgebäude, Gefängnisse, Dienststellen oder Wohnungen von Betroffenen,
- und diese Informationen öffentlich zugänglich machen – in Form einer lebendigen digitalen Karte, die wächst und weiterentwickelt werden kann.
Dazu führen wir regelmäßig Vorträge in Sachsen-Anhalt durch, u. a. an Gedenkstätten, in Schulen und im Rahmen von CSD-Bildungsveranstaltungen. Unser Ziel ist es, die oft als „unsichtbar“ empfundene Geschichte queerer Verfolgung lokal zu verankern und Menschen für diese Zusammenhänge zu sensibilisieren.
Stolpersteine für § 175-Opfer
Ein besonders wichtiger Teil unserer Arbeit ist die Initiative zur Verlegung von Stolpersteinen für nach § 175 verfolgte Personen. Bis heute gibt es in Sachsen-Anhalt nur vereinzelt öffentliches Gedenken an homosexuelle Opfer der NS-Zeit und der Nachkriegsverfolgung. Dabei ist es dringend notwendig, dass auch diese Schicksale gleichwertig in die Erinnerungskultur aufgenommen werden.
Wir recherchieren gezielt nach Biografien von Betroffenen, die aus Sachsen-Anhalt stammen oder hier verfolgt wurden, und setzen uns mit lokalen Initiativen, Gemeinden und der Zivilgesellschaft dafür ein, sichtbare Zeichen der Erinnerung zu schaffen – auf Gehwegen, an Wohnhäusern, in Innenstädten.
Warum das wichtig ist
Das Wissen um die Verfolgung queerer Menschen ist nicht einfach „vergangene Geschichte“. Die langen Schatten des § 175 reichen bis in die Gegenwart. Viele Betroffene haben zeitlebens unter der Stigmatisierung gelitten, verloren ihre Arbeit, ihre Familien, ihre Würde – und oft auch ihr Leben. Nur durch sichtbares, regionales Erinnern kann dieses Unrecht benannt, anerkannt und historisch eingeordnet werden.
Unsere digitale Karte, unsere Vorträge und die Stolperstein-Initiative sind daher kein Selbstzweck. Sie sind ein Beitrag dazu, dass in Sachsen-Anhalt eine offene, diskriminierungsfreie Erinnerungskultur wachsen kann –
getragen von Fakten, Empathie und dem Willen zur Aufarbeitung.
Dieses Projekt wurde unterstützt von der Homosexuellen Selbsthilfe e.V.